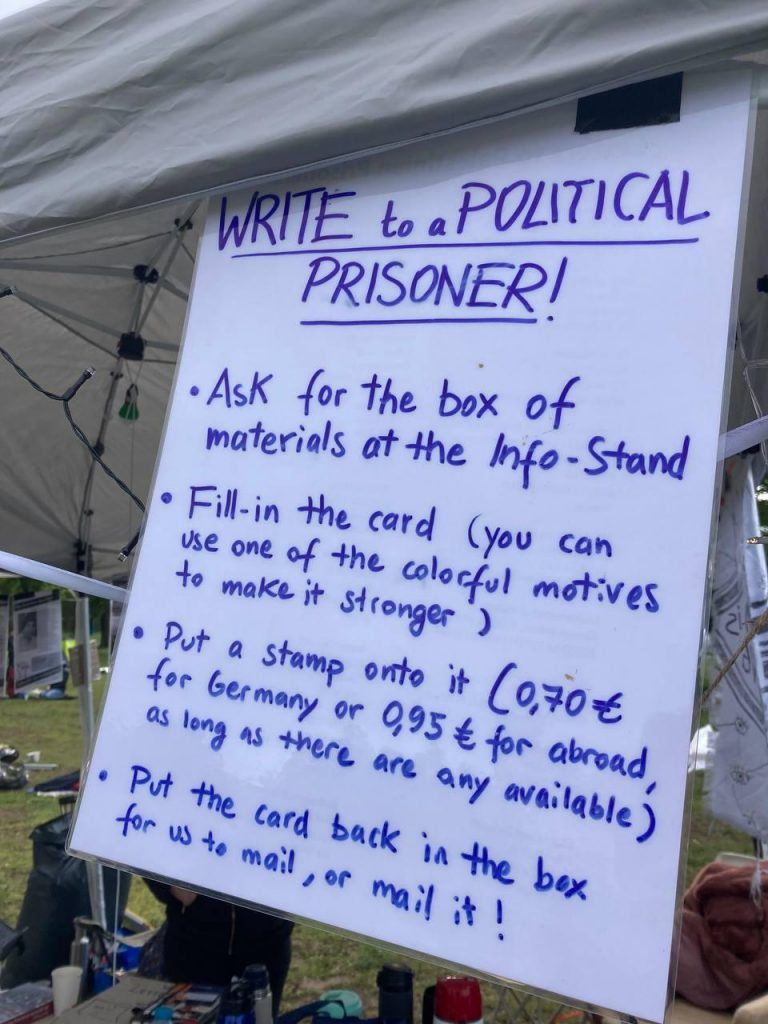In Uruguay kommt die juristische Aufarbeitung der Diktaturverbrechen nur mühsam voran. Noch immer verhindert ein Amnestiegesetz die Ermittlungen zu Menschrechtsverletzungen vor dem 1. März 1985.
Im Museum zur Erinnerung an die Diktatur in Uruguay hängt die Häftlingskleidung von José Mujica, Uruguays heutigem Staatspräsidenten. 14 Jahre hat er im Gefängnis verbracht, nachdem er 1972 als Mitglied der Guerillagruppe Tupamaro verhaftet worden war. Genauso lange steckte der amtierende Verteidigungsminister Eleuterio Huidobro in den Gefängnissen der Diktatur. Auch er war Mitglied der Tupamaro.
n
Doch während in Argentinien seit einigen Jahren den verantwortlichen Militärs der Prozess gemacht wird, kommt in Uruguay die juristische Aufarbeitung der Diktaturverbrechen nur mühsam voran. Ein Amnestiegesetz, das 1986 vom Parlament angenommen wurde, sichert Polizei- und Militärangehörigen Straffreiheit für alle vor dem 1. März 1985 begangenen Menschenrechtsverletzungen zu. Zwar hat der Staat damit streng genommen keine Amnestie erlassen, doch das Gesetz verhindert, dass Ermittlungen aufgenommen werden können – von einigen Ausnahmen abgesehen, die vom Staatspräsidenten genehmigt werden müssen.
Während der Diktatur von 1973 bis 1985 wurden etwa 15 000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Gemessen an der Bevölkerungszahl von drei Millionen, hatte Uruguay damals weltweit die höchste Zahl politischer Gefangener. Die meisten der Gefangenen wurden gefoltert, 116 ermordet. Mitte der 70er Jahre galt Uruguay als »Folterkammer Lateinamerikas«. Über den Verbleib von knapp 200 Personen gibt es bis heute keine Gewissheit.
Unter den Verschwundenen ist Miguel Angel Ríos Casa, der sich politisch gegen die Diktatur engagiert hatte. 1977 wurde der 29-Jährige im Nachbarland Argentinien verschleppt. Sein Sohn Valentín Enseñat war damals sechs Monate alt. »Meine Eltern waren in die Provinz Buenos Aires geflüchtet«, sagt Enseñat. Sein Vater sei sich der Möglichkeit, aufgrund seiner politischen Tätigkeit getötet zu werden, durchaus bewusst gewesen. »Er hat diesbezüglich eine persönliche Entscheidung getroffen. Dazu gehörte aber auch, dass er seinen Sohn vielleicht nicht kennen würde, wenn der groß ist.« Heute ist bekannt, dass die Geheimdienste südamerikanischer Diktaturen damals im Rahmen der sogenannten Operation Cóndor und mit Unterstützung der USA bei der Verfolgung ihrer Gegner zusammenarbeiteten.
Enseñat gründete 1995 zusammen mit anderen Kindern von Verschwundenen die Menschenrechtsorganisation HIJOS. Ähnlich wie ihr argentinischer Vorläufer gleichen Namens organisierten sie sogenannte Escraches. Bei diesen Aktionen werden in Wohnvierteln die Nachbarn mutmaßlicher Menschenrechtsverbrecher lautstark auf deren Vergangenheit aufmerksam gemacht.
Auch Opfern fehlt der Aufklärungswille
Immer wieder gab es in Uruguay Versuche, das Amnestiegesetz aufzuheben – zuerst 1989, dann 2009. Doch die Bevölkerung lehnte das in einem Referendum ab. Im März 2011 erklärte der Oberste Gerichtshof das Gesetz für verfassungswidrig. Damit war der Weg frei für Einzelklagen. Bisher kam es aber nur in wenigen Fällen zu Verurteilungen. Zwar ist das Amnestiegesetz bis heute nicht aufgehoben. Im Oktober 2011 stimmten die Parlamentarier jedoch dafür, dass Menschenrechtsverbrechen nicht verjähren. Damit wurde der staatliche Rechtsverfolgungsanspruch gegenüber diesen Verbrechen wiederhergestellt.
Doch nicht nur wegen des Amnestiegesetzes sind die Täter bisher nicht zur Verantwortung gezogen worden. Obwohl mit Mujica und Huidobro heute zwei Opfer der Diktatur in höchsten Staatsämtern sind, lassen sie Aufklärungswillen vermissen: »Das regelt sich alles, wenn wir tot sind«, sagt Mujica. Wer für diese Politik in der Hauptstadt Montevideo nach Erklärungen sucht, schaut meist in fragende Gesichter. Es wird von Absprachen zwischen den Tupamaros und den Streitkräften gemunkelt. Schließlich verbinde beide die militärische Logik von Sieg und Niederlage. Andere bemühen den Begriff des Stockholmsyndroms, bei dem zwischen Täter und Opfern eine emotionale Bindung entsteht.
Seit 2002 gibt es eine zaghafte rechtliche Aufarbeitung, die von Menschen wie Staatsanwältin Mirtha Guinze betrieben wird. Oft müssen sie und ihre Kollegen mit Unterlagen aus argentinischen, chilenischen oder paraguayischen Archiven arbeiten, die sie aber nicht weiterbringen. Guinze glaubt, dass noch immer die Militärs die Archive kontrollieren und nicht der Minister, wie es eigentlich sein sollte. »Viele Menschen wissen nichts über das Ausmaß des Horrors, der hier passiert ist. Das steht in den Akten – aber nur selten in den Zeitungen.« Dennoch stehe laut Guinze der Gerechtigkeit juristisch nichts im Wege. Der Grund: ein Urteilsspruch des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte (CIDH). Der hatte im März 2011 in einem Präzedenzurteil der Klage des argentinischen Schriftstellers Juan Gelman entsprochen, gemäß der die uruguayischen Justizbehörden ein Ermittlungsverfahren einleiten müssen. Es geht um den Fall seiner schwangeren Schwiegertochter María Claudia García, die im Jahr 1976 verschwand und deren Baby illegal weitergegeben wurde. Zudem forderten die Richter des CIDH von Uruguay, alles Nötige zu tun, damit das Amnestiegesetz kein Hindernis mehr für die Ermittlungen bei Menschenrechtsverletzungen sei.
»Für mich als Staatsanwältin ist bereits mit dem Urteil des CIDH unser Amnestiegesetz nicht mehr rechtskräftig, denn wir sind verpflichtet, dieses Urteil umzusetzen«, sagt Guinze. Dass die Regierung dennoch weiter mauert, erklärt sie damit, dass viele Tupamaros nichts mehr von der Vergangenheit wissen wollen, seit sie ihre Waffen abgegeben haben. »Sie sehen sich als Kriegsverlierer und wollen nur noch nach vorne schauen.«
Für den Journalisten Samuel Blixen gibt es noch ein anderes Motiv: »Viele Militärarchive sind bis heute nicht gefunden worden.« Möglicherweise enthalten sie auch Material der Verhöre Mujicas und anderer, das als Druckmittel gegen jene verwendet werde, die heute an der Regierung sind. Doch es habe ohnehin nie viel Zustimmung für die Aufhebung des Gesetzes gegeben. Noch immer steht fast die Hälfte der Bevölkerung hinter den jetzt oppositionellen Parteien. »Die politische Rechte des Landes will die Straflosigkeit und keinerlei Ermittlungen«, sagt Blixen. »Und ein großer Teil der Bevölkerung teilt diese Auffassung.« Die derzeitige Regierung habe deswegen stets auch diesen Teil der Bevölkerung im Auge.
Staatsterrorismus wurde öffentlich zugegeben
In der Art und Weise, wie die ehemaligen Guerilleros und die Angehörigen der Opfer der Diktatur Vergangenheitsbewältigung betreiben, sieht Enseñat große Unterschiede: »Bei den Familien der Tupamaros sind die Verschwundenen kein Thema, respektive gelten als Märtyrer.« Zudem gebe es eine offizielle, um die Anführer konstruierte Geschichtsschreibung. Keiner der wichtigen Gedenktage der Tupamaros habe etwas mit den Verschwundenen zu tun.
Personen wie Mujica und Huidobro sei zwar klar, »dass sie das, was passiert ist, überwinden müssen«, sagt Enseñat. »Doch sie tun dies nicht, indem sie das Geschehene juristisch aufarbeiten, sondern einfach, indem sie es ignorieren und verdrängen.« Dass die Folterer für Straffreiheit eintreten, überrasche niemanden. »Aber es erschreckt mich, dass die Straflosigkeit der Menschenrechtsverletzungen in Uruguay auch durch die Haltung der Opfer unterstützt wird.«
Doch es gibt Hoffnung: Vergangene Woche erkannte Präsident Mujica das Urteil des CIDH im Fall von María Claudia García offiziell an. In einer Rede im Parlament sagte er: »Als Opfer des Staatsterrorismus haben García und ihre Familie das Recht, dass der Staat Wiedergutmachung leisten muss und ethisch zur Verantwortung gezogen wird für die Taten, die sie erlitten haben.« Ein uruguayischer Präsident sprach damit erstmals öffentlich vom »Staatsterrorismus« während der Diktatur und davon, dass sich der uruguayische Staat in die von den südamerikanischen Militärdiktaturen verfolgte Operation Cóndor hat einbinden lassen, um politische Gegner grenzüberschreitend zu verfolgen, zu töten oder verschwinden zu lassen.