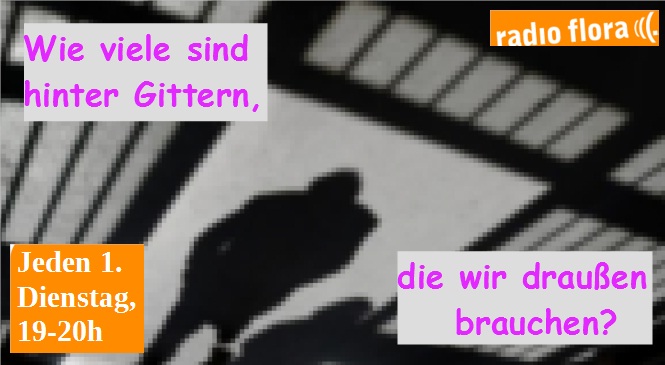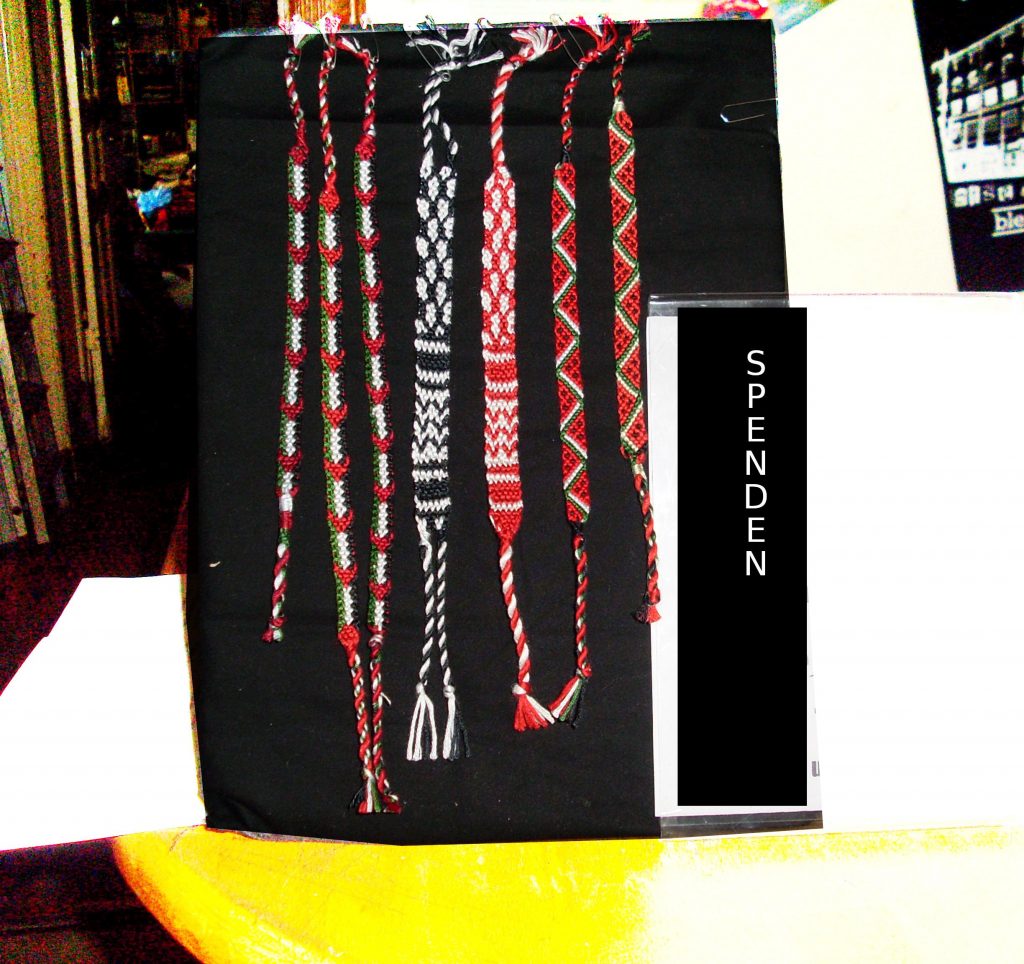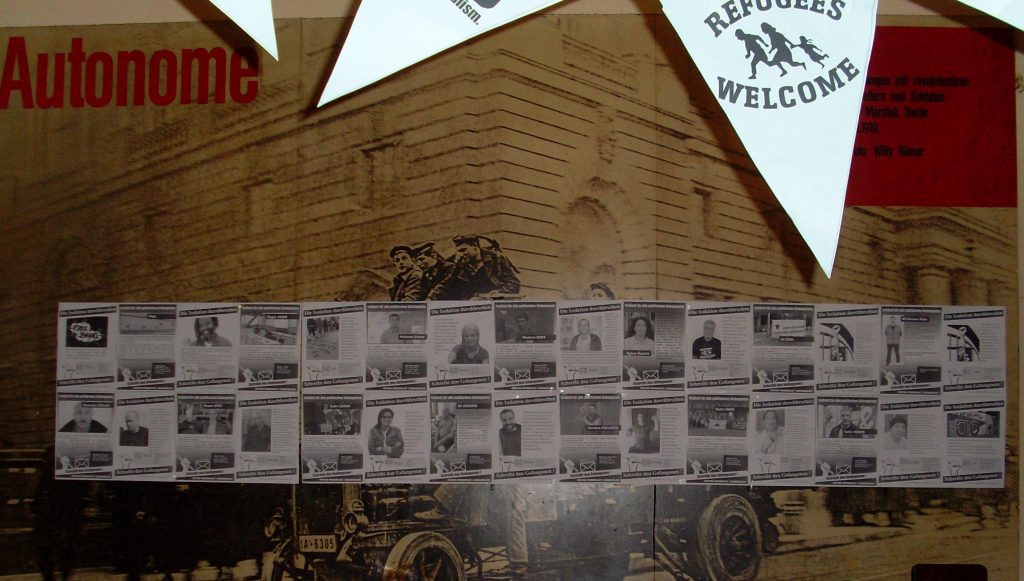Aktuell laufen bundesweit mehrere Großprozesse gegen Revolutionär:innen und mit den Prozessstarts im Budapest-Komplex in den kommenden Wochen stehen weitere an. Parallel erleben wir auch eine immer weitere Verschärfung der Repression, einen Ausbau polizeilicher und geheimdienstlicher Mittel und engere Handlungsräume für revolutionäre Politik. Gefängnisstrafen werden häufiger, es gibt so viele politische Gefangene aus Bewegungen in Deutschland wie schon lange nicht mehr und eine Diskussion zum Umgang mit Repression, mit Haft und Untergrund ist wieder aktuell. Neben Repression ist die andere Seite der Medaille immer die Solidarität: auf der Straße, vor Gericht, im Knast – als Grundlage zur Gestaltung eines gemeinsamen Kampfes und in Einheit im Angesicht der Angriffe des Staates. Auch Charakter und Bedeutung von Solidarität stehen immer wieder zur Diskussion, weswegen wir hierzu unsere Gedanken teilen wollen.
Repression zur Herrschaftssicherung im Kapitalismus
Wir verstehen unter Repression alle Mittel, die zur Aufrechterhaltung kapitalistischer Herrschaft eingesetzt werden. Hierunter fallen einerseits die unmittelbaren Reaktionen des Staates, der die Interessen der Kapitalist:innen vertritt und durchsetzt, auf spontane Proteste: Polizeigewalt auf der Straße, Spitzel und VS-Ansprachen, Geldstrafen, Knast, aber auch eine politische Delegitimierung und der Versuch der Entpolitisierung fortschrittlicher Kämpfe. Andererseits umfasst Repression auch Sanktionen des Jobcenters oder Stress auf der Arbeitsstelle oder in der Schule. Diese verschiedenen Formen der Repression nehmen dabei unterschiedliche Rollen ein. So richten sich Polizeigewalt oder unmittelbare Strafen gegen stattfindende Kämpfe und Widerstand gegen das kapitalistische System und sollen direkt einschüchtern und eine Anpassung des eigenen Verhaltens erzwingen. Besonders aber im Zusammenspiel mit kostspieligen Gerichtsverfahren oder Haftstrafen soll das Entstehen einer schlagkräftigen und gut organisierten revolutionären Bewegung verhindert werden. Auch in unserem Bewusstsein soll diese vermeintliche Allmacht des deutschen Staates gefestigt werden. Als Bewegung soll uns das nach innen kehren und uns mit uns selbst und der Repression beschäftigen.
Strafe und die Möglichkeit der (Re-)Integration in die bürgerliche Gesellschaft sind dabei zwei Seiten der gleichen Medaille. Oft geht beides miteinander einher und die Androhung der Strafe macht Integrationsangebote erst ansprechend, während auf der andere Seite klar ist: wer sich nicht anpasst, erfährt Gewalt auf der Straße, Zwang im Amt und Unfreiheit im Gefängnis. Das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche gilt auch heute noch unverändert. Welche Formen Repression dabei annimmt, wird schlussendlich immer situations- und fallbedingt entschieden, verfolgt aber das gleiche Ziel, dass wir als Individuen und Strukturen den Kampf für eine andere Gesellschaft aufgeben. Mit der Zuspitzung kapitalistischer Krisen, Aufrüstung nach Außen und Militarisierung nach innen wird erkennbar, dass der Staat immer repressiver vorgeht und sich auf die Sicherung der eigenen imperialistischen Vormachtstellung, auf eine Zuspitzung von internationalen Klassenkämpfen und Widerstand gegen den Kapitalismus präventiv vorbereitet. Konkreter Ausdruck dessen sind die unzähligen Polizeigesetzverschärfungen der letzten Jahre, mehr Polizeigewalt auf der Straße und immer härtere Strafen für Alle, die sich dem widersetzen. Das haben wir zum Beispiel beim Urteil gegen Hanna erneut gesehen. Hanna war nicht untergetaucht, nicht vorbestraft und hat für eine Straftat die bei Faschist:innen oder sonstigen Gewalttäter:innen meist mit einer bewährungsfähigen Strafe geahndet wird, 5 Jahre Haft bekommen. Der Richter argumentierte hier mit der fehlenden Kooperation der Beschuldigten und einem gefestigten politischen Weltbild. Der gesamte Budapest-Komplex, in dem das Urteil gegen Hanna das erste in Deutschland ist, wurde in den vergangenen Jahren dazu genutzt, öffentlich militanten Widerstand zu delegitimieren und das staatliche Gewaltmonopol zu verteidigen.
Die integrative Wirkung von Repression tritt dabei in der Wahrnehmung oft stärker in den Hintergrund. Ob es Dealangebote vor Gericht sind, die Stadtteilgruppe, die ins städtische Quartiersmanagement integriert wird oder die Ruhigstellung von Gefangenen, wenn ihnen gesagt wird, dass sie nicht ihre 2/3 Strafe riskieren sollten – immer werden die Vorzüge eines bürgerlichen Lebens bzw. deren Verlust benutzt, um eine Anpassung des Verhaltens zu erreichen. Dabei wird immer das Bewusstsein der Betroffenen über ihre eigene Situation und politische Perspektive auf die Probe gestellt. Das Ziel ist die Entpolitisierung, die Isolierung von Beschuldigten und dass wir uns nur noch um uns selbst drehen. Die Funktionsweise von Repression ist immer ganzheitlich gegen eine linke Bewegung gerichtet.
Am Ende ist es also unser aller Aufgabe, ein entsprechendes Bewusstsein über die Funktionsweise staatlicher Repression zu entwickeln und uns gegenseitig darin zu bestärken, uns als Teil eines gemeinsamen Kampfes gegen Kapitalismus und Patriarchat zu verstehen, damit solche Angebote ins Leere laufen.
Einlassungen und Deals politisch verstehen
Insbesondere die Diskussion über Einlassungen oder Deals vor Gericht wurde in den vergangenen Jahren kontroverser diskutiert. Dabei muss zwischen Einlassung zur Sache vor Gericht und Deals unterschieden werden. Bei Einlassungen werden Teile oder die gesamte Anklage gestanden, jedoch keine weitere Aussage getroffen. In der Regel wird ein solches Handeln strafmildernd gewertet und ist mit der Zusage an eine Strafe in einem bestimmten Rahmen verbunden. Zwar wird auch bei Einlassungen im engeren Sinne „gedealt“, allerdings die Grenze zu politischen Distanzierungen, Reue oder der Belastung Anderer nicht überschritten. Bei weitergehenden Deals verstehen wir auch diese Grenzen überschritten, beispielsweise wenn sich zusätzlich von den vorgeworfenen Taten distanziert wird oder es gar zu weitergehenden Aussagen kommt – immer mit dem Ziel, Vorteile für sich selbst herauszuschlagen. Im letzteren Fall ist damit auch eine Grenze der Solidarität überschritten.
Bei Deals in Form von Einlassungen ist dies nicht so einfach zu sagen. Diese können beispielsweise in Form eines offensiven Bekenntnisses zu den vorgeworfenen Taten und deren politischer Verteidigung verknüpft ein politisierendes Moment sein. Ausschlaggebend in der Bewertung muss für uns die Motivation, kollektive Diskussion und Zielsetzung hinter einem solchen Vorgehen sein. Klar muss auch sein, dass es in Strafverfahren und vor Gericht nichts umsonst gibt. Die Trennlinie zwischen Beschuldigte:r und Gericht oder Schließer; zwischen kämpfender Bewegung und dem Staat, der diese zerschlagen will, verschwimmt. Wir denken, Klarheit in dieser Frage schafft auch Halt und Stabilität und kann es Betroffenen besser ermöglichen, sich im Angesicht der Repression selbst zu ermächtigen. Anders herum: wenn Beschuldigte einmal Bereitschaft zur Kooperation zeigen, lassen die Behörden nicht locker und durch die Drohung, Erleichterungen oder Angebote im Knast wieder zu verbieten bzw. der hohen Strafe vor Gericht, geben wir das Heft des Handelns eher aus der Hand, als selbstbestimmt aufzutreten. Bei Deals und defensiven Einlassungen setzen wir unsere Hoffnung in den Staat und seine Organe, die doch gerade uns einsperren und tagtäglich Schikane und Gewalt aussetzen.
Die Verantwortung damit zu brechen, tragen jedoch nicht Beschuldigte oder Gefangene allein. Vor allem als Bewegung haben wir die Verantwortung und stehen vor der konkreten Aufgabe, offensive Prozessstrategien zu begleiten und unsere Genoss:innen dabei, zu unterstützen. Es gilt für die Betroffenen von Repression da zu sein, sie und ihre Umfelder zu unterstützen, Repressionsfolgen kollektiv aufzufangen und Gerichtsverfahren und kommende langjährige Haftstrafen ausdauernd zu begleiten. Dabei gilt es zu beachten wie wir auch weiter fortschrittliche Teile der Gesellschaft erreichen und unseren Einfluss ausbauen können, anstatt uns – wie beabsichtigt – um uns selbst zu drehen.
Solidarität ist unsere Waffe
Solidarität ist die Einsicht, dass uns ein gemeinsamer Kampf für eine bessere Zukunft eint. Wer also für eine Welt frei von Faschismus, von Patriarchat, von Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen kämpft – dem sollte unsere Solidarität gelten. Das ist die einzige Bedingung, an die unsere Solidarität geknüpft sein sollte. Die Logik „ich helf dir, damit du mir hilfst“ ist Ausdruck kapitalistischer Denkweisen, die das eigene Handeln an eine Entlohnung knüpft und darf keinen Platz haben. Nur solidarisch zu sein, wenn Betroffene auch persönlich bekannt oder gemocht werden individualisiert uns nur weiter und verstärkt die Wirkung von Repression.
Klar ist, dass unterschiedliche Strömungen einer revolutionären Linken dann auch unterschiedliche Meinungen und Wege haben, diesen Kampf zu führen. Diese Diskussionen und Widersprüche müssen wir solidarischer, kontroverser aber auch offener diskutieren, um daran wachsen zu können. Aber geht es um die Konfrontation mit staatlicher Repression und werden einzelne von uns angegriffen und sollen eingemacht werden muss eines klar sein: wir stehen zusammen! Genau in diesen Momenten sollten politische Widersprüche nicht zum Tragen kommen, sondern der gemeinsame – wenn auch in Form oder Zielsetzung unterschiedliche – Kampf und die Abwehr der Angriffe des Staates im Vordergrund stehen. Insbesondere wenn es darum geht, Betroffene vor Gericht oder Gefangene im Knast zu unterstützen und begleiten, muss dieser Grundsatz die Grundlage gemeinsamen Handelns sein.
Denn solidarisch handeln bedeutet, ganz konkret den Einfluss des herrschenden Kapitalismus und Patriarchat auf unsere Beziehungen zurück zuweisen und diesem mit eigener Kollektivität zu entgegnen. Für die eigene Solidarität wird eine Gegenleistung erwartet oder anders herum: „jetzt halte ich für euch alle meinen Kopf hin, dann seid solidarisch und zahlt die Anwält:in“. Klingt das auch überspitzt, sehen wir in solchen Denkweisen den Einfluss kapitalistischer Verwertungslogik und im schlimmsten Fall wird unsere Solidarität zu einer Ware, die nur gegeben wird, wenn ein Preis (bzw. bestimmte Bedingungen oder Handeln vor Gericht etc.) erfüllt ist. Unsere Solidarität ist ihrem Wesen nach etwas selbstverständliches, das in unseren Alltag und in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen Einzug halten sollte. Denn solidarisch Handeln bedeutet, ganz konkret denn Einfluss der herrschenden Klasse und des Kapitalismus und Patriarchats und den damit verbundenen Individualismus auf die Beziehungen der Menschen einzudämmen.
In den vergangenen Jahren ist die Diskussion über einen Umgang mit patriarchalem Verhalten und patriarchaler Gewalt in der linken Bewegung richtigerweise verstärkt geführt worden. Patriarchales Verhalten und patriarchale Gewalt in all ihren Formen sind nicht nur in der kapitalistischen Gesellschaft, sondern genauso in der linken Bewegung verbreitet. Auch in Antirepressionsstrukturen hat sich diese Diskussion niedergeschlagen. Klar muss sein, dass mit patriarchalem Verhalten und patriarchaler Gewalt konsequent umgegangen werden muss, auch wenn der Täter an anderer Stelle von Repression betroffen ist. Taten, welche einen Ausschluss aus der linken Bewegung und Kontaktabbrüche nach sich ziehen, müssen auch entsprechende Auswirkungen auf etwaige Solidaritätsarbeit haben. Der Kontext des Verfahrens, die weitere Solidarität mit gemeinsam Beschuldigten und der Schutz der eigenen Strukturen sind dabei Punkte, die im konkreten Fall mit diskutiert werden müssen. Gleichzeitig müssen wir uns, wenn Aufarbeitungsprozesse geführt werden und es die Bereitschaft zur Reflektion und Veränderung gibt auf die Strukturen, die die Arbeit mit den Personen machen verlassen und ist die Frage der Solidarität davon vorerst nicht berührt. Entziehen wir unsere Solidarität bedeutet es, dass wir davon ausgehen, dass es keinerlei Grundlage mehr für einen gemeinsamen politischen Kampf mit der Person mehr gibt.
Unterschiedliche Aspekte und Akteur:innen in der Soli-Arbeit
Für die effektive Unterstützung der Betroffenen und ihrer Umfelder ist es unerlässlich, dass Familie und Freund:innen einen festen Platz in der Solidaritätsarbeit haben, unterstützt werden und Teil davon sind, den Repressionsfall in seiner politischen Dimension zu analysieren und darauf zu reagieren. Insbesondere diese Aufgabe tragen wir jedoch als Bewegung in der Begleitung und auch Auseinandersetzung mit den Betroffenen selbst. Oft ist es beeindruckend, wie aktiv Eltern und persönliche Umfelder von Betroffenen in der Solidaritätsarbeit sind und – sofern diese nicht eh schon selbst politisch aktiv sind – auch bei ihnen über die Arbeit eine Politisierung stattfindet. Gleichzeitig entbindet das uns nicht von der Pflicht selbst aktiv zu sein, die politische Dimension eines Repressionsfalles offen zu legen und die Eltern und Umfelder von Betroffenen in ihren Sorgen und Ängste um das eigene Kind, die Partner:in oder Freund:in alleine zu lassen. Vielmehr muss es uns darum gehen, die persönlichen und familiären Umfelder von Betroffenen in der gemeinsamen Arbeit zu politisieren, um dadurch auch die Betroffenen von Repression und Gefangenen in ihrer politischen Haltung vor Gericht und im Knast zu stärken. Nur wenn wir dahin kommen, Ängste und Sorgen kollektiv aufzufangen schaffen wir die Grundlage, auf der eine stabile politische Prozessführung erfolgreich sein kann, aus der Analyse der Repression und ihrer Wirkweise und dem gemeinsamen Agieren die Ohnmacht durchbrochen werden kann, sowie ein Moment der Selbstermächtigung entsteht. Dafür braucht es politische Solidaritätszusammenhänge, die unabhängig von einem persönlichen Verhältnis zu und im engen Verhältnis zu Unterstützungsgruppen und Umfeldern von Betroffenen die politische Dimension eines Verfahrens nicht aus den Augen verlieren. Zu einem solidarischen Grundkonsens muss dabei auch gehören, dass alle Formen der Solidarität – insbesondere auch militante Formen – ihre Berechtigung haben und es zu keinen Distanzierungen von ihnen kommt.
Auch die Betroffenen und insbesondere unsere Gefangenen, die sowieso nur eingeschränkte Möglichkeiten des Austausches besitzen, dürfen wir dabei nicht als Objektive betrachten. Ziel muss es sein, sie dazu zu befähigen, politisch handelnde Subjekte zu werden, sie bestmöglich in einen solidarischen Austausch einzubinden und auch zu kritisieren. Insbesondere bei politischen Gefangenen müssen wir die Gefahr erkennen, politische Diskurse nicht oder nur bedingt mit ihnen zu führen. Haben sie keine Möglichkeit des politischen Austausches mit uns, überwiegt oft eine rein juristische Perspektive durch den vergleichsweise engeren Austausch mit Anwält:innen oder wirkt die Repression in ihrer Entpolitisierung und Vereinzelung.
Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben!
Ausblick auf Antirepressionsarbeit
Wenn wir davon ausgehen, dass sich die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Krisen weiter zuspitzen, müssen wir auch davon ausgehen, dass sich die Repression gegen linke und revolutionäre Bewegungen weiter zuspitzt. Mit unserer Antirepressionsarbeit müssen wir versuchen dem Rechnung zu tragen und langfristige, politische Antirepressionskollektive schaffen. Neben der Unterstützung der Betroffenen, der Organisierung finanzieller Unterstützung, Begleitung von Gerichtsverfahren und unserer Gefangenen muss es auch darum gehen, diese Arbeit in einen Zusammenhang zu unseren alltäglichen Kämpfen zu setzen. Damit kann es gelingen, die Repression nicht nur in die Leere laufen zu lassen, sondern auch Potentiale aus erfolgreicher Antirepressionsarbeit zu nutzen und den Spieß der Repression tatsächlich um zudrehen. Insbesondere die Begleitung und Einbindung der Gefangenen, gegen die Isolation und Vereinzelung in den Gefängnissen, ist dabei ein Herausforderung der kommenden Jahre. Auf der Grundlage der Solidarität – der Erkenntnis eines gemeinsamen Strebens nach einer besseren Gesellschaft – können wir es schaffen, weit verbreitetes Gruppendenken zu überwinden und gemeinsam an Repression zu wachsen. Ohne dieses Verständnis von strömungsübergreifender Solidarität – in Worten und in Taten – werden wir schnell an unsere Grenzen stoßen und eine nach dem anderen alleine vereinzelt. Ohne langfristige und politische Antirepressionsstrukturen werden wir immer wieder von Neuem zurückgeworfen.
Diese Diskussion möglichst breit zu führen ist notwendig – für strömungsübergreifende Solidarität; für eine starke revolutionäre Bewegung!
Freiheit und Glück allen Genoss:innen in Untergrund und Haft!
Arbeitskreis Untergrund