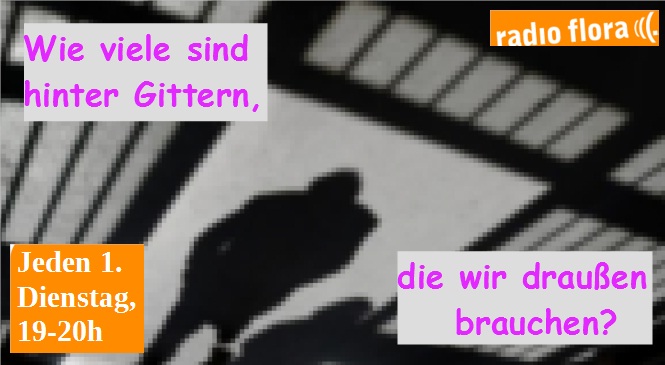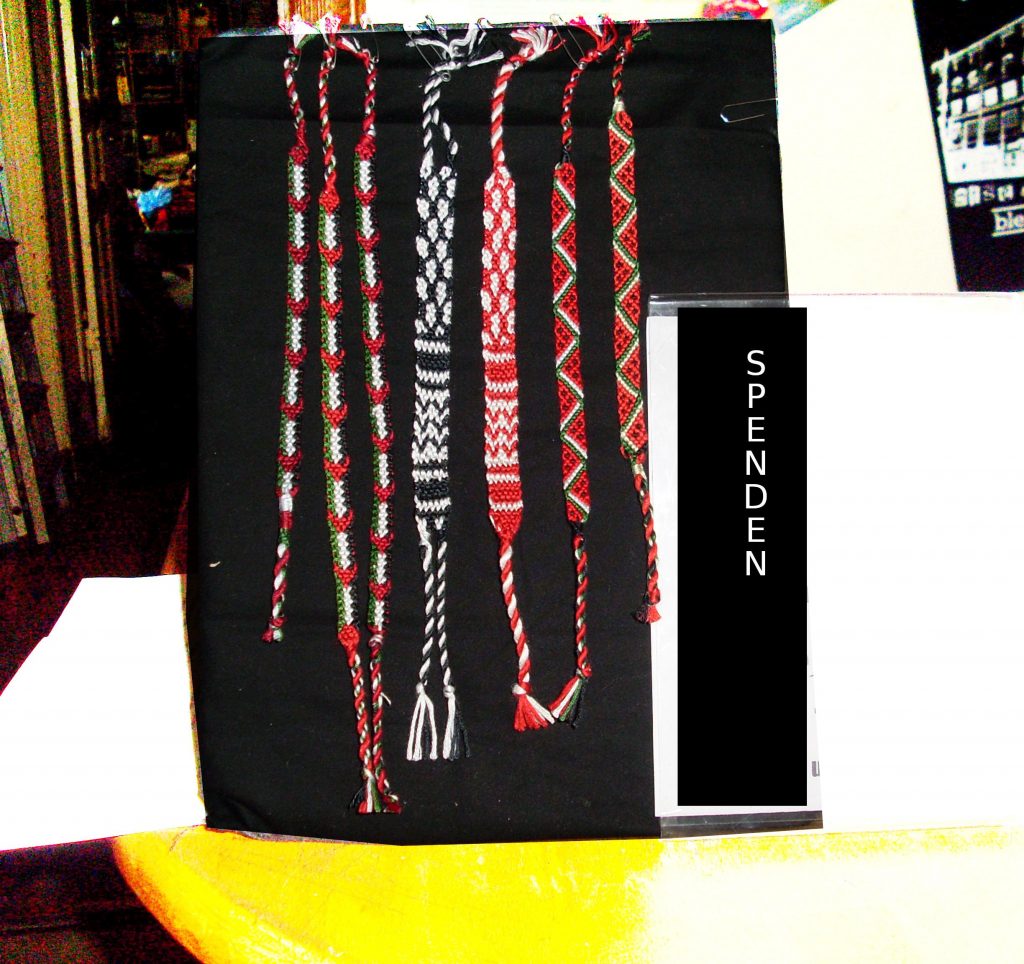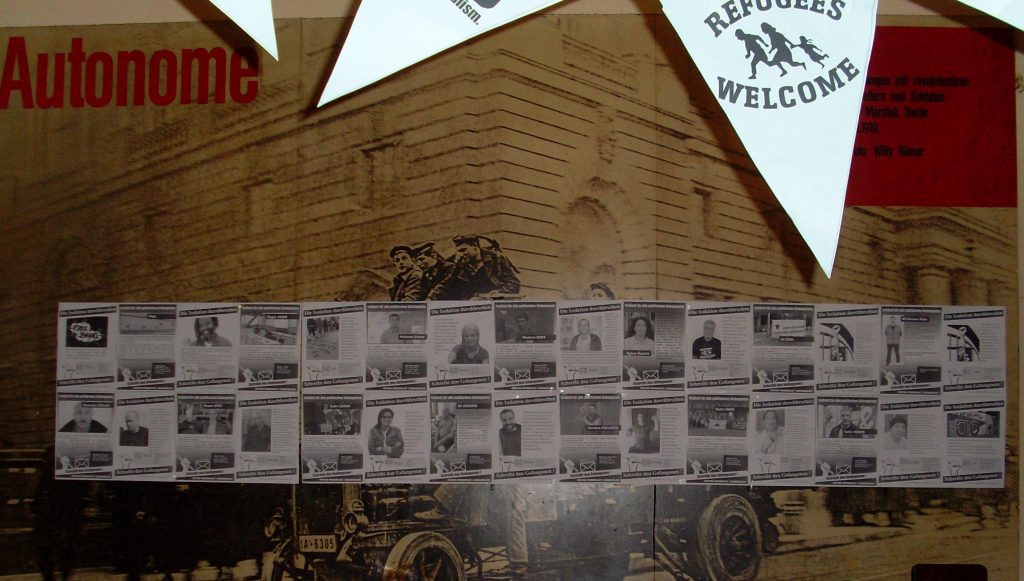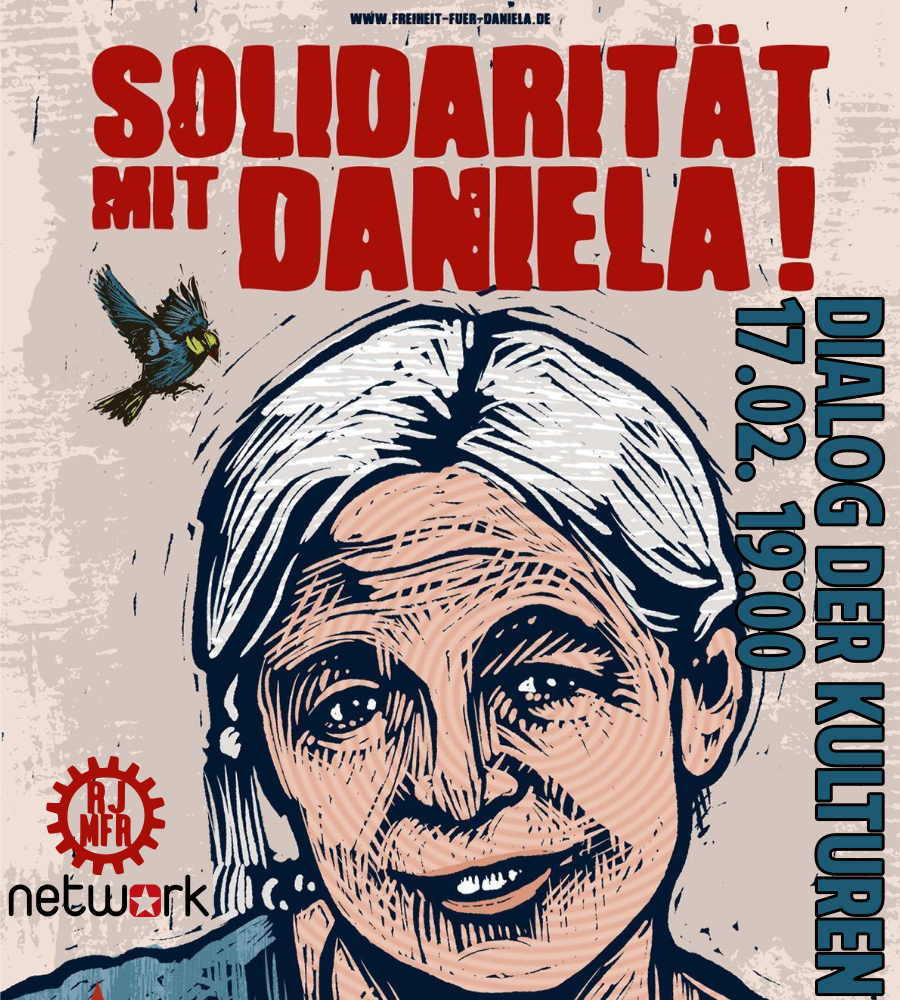Mo ist Hafenarbeiter in Hamburg, Gewerkschaftsmitglied, politisch engagiert – und Palästinenser. Im Interview erzählt er, was er seit der Eskalation in Gaza bei ver.di erlebt: Schweigen, Ausweichen, Ausschluss. Klare Worte und Taten angesichts der katastrophalen Lage und genozidalen Kriegsführung der israelischen Armee in Gaza bleiben von der DGB-Gewerkschaft weiter aus.
Wie hast du persönlich die Zeit seit Beginn des Kriegs in Gaza erlebt – auch in Bezug auf deine Rolle in der Gewerkschaft?
Die Eskalation in Gaza hat mich direkt getroffen. Ich stamme aus Rafah, bin seit 2015 hier in Deutschland. Meine Eltern und zwei Schwestern leben dort. Mein Bruder wurde am 6. Februar 2024 in Gaza ermordet. Ich habe bereits als junger Mensch miterlebt, wie die amerikanische Menschenrechtsaktivistin Rachel Corrie am 16. März 2003 in Rafah von der israelischen Armee ermordet wurde.
Meine Familie wurde mehrfach vertrieben, sie mussten zu oft ihre Häuser und ihr soziales Umfeld verlassen und fliehen. Das ist für mich keine Nachricht aus der Ferne – das ist mein Alltag, mein Leben.
Und dann kam das Schweigen von ver.di. Ich bin seit Jahren engagiertes Mitglied, habe am Hamburger Hafen meine Ausbildung gemacht, mich tarifpolitisch eingebracht. Aber als ich Solidarität gebraucht hätte, kam nichts. Es war nicht nur Schweigen. Es war ein Ausschluss.
Wie nimmst du die öffentliche und gewerkschaftliche Reaktion auf den Krieg in Gaza wahr? Was denkst du, steckt dahinter?
Ich habe mich früh und mehrfach an ver.di gewandt. Am 24. Februar 2025 habe ich eine E-Mail geschrieben – auch an Vertrauensleute im Betrieb. Die Antwort kam erst am 20. März von Seiten der Gewerkschaft: Ja, es wurde emotionale Solidarität geäußert – aber keine praktische.
Ich habe weitergemacht, beim Ostermarsch mitorganisiert, mich mit dem Arbeitskreis Frieden vernetzt, im Juni ein Interview für die ver.di-Zeitung angeboten bekommen. Es gibt engagierte Kolleg:innen, aber strukturell fehlt der Wille, hinzusehen.
Die offizielle Linie vieler deutscher Gewerkschaften vermeidet eine klare Positionierung zum Krieg in Gaza. Wie erklärst du dir dieses Schweigen?
Für mich ist das heuchlerisch, feige und rassistisch. Ich habe selbst erlebt, wie laut und deutlich sich ver.di mit der Ukraine solidarisiert hat: Veranstaltungen, Plakate, politische Statements. Aber bei Palästina? Nichts.
Warum diese Unterschiede? Warum zählt das Leben palästinensischer Kinder weniger? Das hat nichts mit „Neutralität“ zu tun – das ist selektive Solidarität. Und an den Gebäuden steht: „Solidarität kennt keine Grenzen“. Ich aber habe als Palästinenser jede Grenze gespürt. Das ist struktureller Rassismus.
Was macht es mit dir, wenn deine Perspektive ignoriert wird, trotz mehrfacher Versuche, gehört zu werden?
Es macht einsam. Es fühlt sich an wie ein Ausschluss aus der eigenen Organisation. Ich bin nicht nur betroffen, ich bin aktiv, ich kämpfe, ich lese, ich bilde mich politisch. Aber wenn das alles ignoriert wird, wenn mein Leid nicht zählt, weil es nicht ins politische Bild passt, dann verletzt das.
Ich will kein Mitleid, ich will Anerkennung und Haltung.
Siehst du darin einen Einzelfall oder ein grundsätzlicheres Problem innerhalb der Gewerkschaftsbewegung?
Ganz klar: Es ist strukturell. Die Basis, viele Kolleginnen – die fühlen mit. Viele sind gegen Krieg, viele sehen das Leid. Aber die Gewerkschaftsführung ignoriert diese Stimmen.
Es gab eine repräsentative Umfrage der in Deutschland lebenden Bevölkerung des ZDF im vergangenen Jahr. Daraus geht hervor, das 70 Prozent der Bevölkerung einen Waffenstillstand wollen oder sich gegen Waffenlieferungen aussprechen.
Die Gewerkschaften hätten das aufnehmen müssen, aber sie haben sich entschieden, den Kurs der Bundesregierung zu stützen. Es geht um Karrieren, um Posten, um Nähe zur Macht. Und nicht mehr um das, was die Arbeiter:innen wollen oder brauchen.
Gewerkschaften betonen Solidarität als zentrales Prinzip. Erlebst du diese Solidarität?
Nein. Ich sehe Solidarität – aber nicht für Palästina. Ich sehe Lippenbekenntnisse, Relativierungen, Schweigen. Aber selbst nach über 30.000 ermordeten Kindern in Gaza – nichts. Ich habe mir gewünscht, dass meine Gewerkschaft sagt: Das ist Unrecht. Punkt. Aber das kommt nicht. Stattdessen: Wegschauen.
Es scheint, als werde mit zweierlei Maß gemessen.
Absolut. Die Solidarität mit der Ukraine war laut, sichtbar, sofort. Mit Palästina – nichts. Das zeigt: Das Leben von Palästinenser:innen hat für viele Institutionen in Deutschland keinen gleichen Wert. Und das ist rassistisch – klar und deutlich.
Hast du innerhalb der Gewerkschaft Unterstützung erlebt?
Einzelne Kolleg:innen haben mich unterstützt, haben mit mir gesprochen, sich eingesetzt. Aber strukturell war ich isoliert. Ich habe immer wieder geschrieben, organisiert, Gespräche gesucht. Aber es kam sehr wenig zurück und oft erst viel zu spät.
Das macht etwas mit einem. Du fühlst dich fremd in deiner eigenen Gewerkschaft, die ja deine Interessen und Belange vertreten müsste und auch einen Schritt auf die Mitglieder zugehen sollte.
Was erwartest du konkret von deiner Gewerkschaft?
Worte sind wichtig – aber sie müssen klar und mutig sein. Und Taten müssen folgen.
Ich will, dass unser Leid anerkannt wird. Ohne Relativierung. Ohne „aber“.
Man sagt zu Recht: Der Holocaust darf nie relativiert werden. Dann darf auch das, was in Gaza passiert, nicht relativiert oder ignoriert werden. Wenn du „nie wieder“ ernst meinst, dann musst du es immer sagen – nicht nur, wenn es bequem ist.
Viele Menschen mit arabischem Hintergrund fühlen sich in der politischen Debatte zunehmend delegitimiert.
Ich erlebe das jeden Tag. Oft werde ich nicht als politisch denkender Mensch wahrgenommen, sondern nur als „der Migrant, der betroffen ist“. Aber ich will nicht immer diese Rolle zugewiesen bekommen. Ich bin Arbeiter. Mensch. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Ich lese, ich denke, ich engagiere mich.
Ich habe mich beispielsweise viel mit Literatur und der Forschung über den Holocaust und den Faschismus auseinandergesetzt. Das ist ein essentieller Teil meiner politischen Haltung und Weiterbildung. Wenn du das alles übergehst, weil ich Mohammed heiße und aus Gaza komme, dann ist das Rassismus – auch wenn man es nicht so benennt auf den ersten Blick.
Was müsste passieren, damit sich palästinensische Stimmen wirklich als Teil einer gemeinsamen gewerkschaftlichen Bewegung fühlen können?
Die Gewerkschaft muss ihre eigenen Grundsätze ernst nehmen: „Solidarität kennt keine Grenzen“ – das muss gelten, auch wenn es unbequem ist. Auch für Palästinenser:innen. Ich wünsche mir, dass meine Geschichte zählt. Dass meine E-Mails nicht ignoriert werden. Dass Aktionen sichtbar gemacht werden.
Ich wünsche mir, dass wir laut sagen: Nicht in unserem Namen. Dass wir gemeinsam aufstehen, unsere Stimme erheben. Ohne Angst. Denn unser Leben ist nicht wertlos. Und unser Kampf ist nicht separat – er ist Teil des gemeinsamen, internationalen Kampfes aller arbeitenden Menschen.
Welche Verantwortung siehst du bei linken Medien, Organisationen und Kolleg:innen?
Sie müssen ihre Stimme nutzen. Sie dürfen nicht schweigen – nicht aus Angst, nicht aus Opportunismus. Ich werde das Schweigen von Institutionen nie vergessen – und ich werde es nicht vergeben.
Aber ich sehe auch: Es gibt viele, die sich einsetzen. Kolleg:innen, Journalist:innen, Einzelne, die sagen: Wir kämpfen weiter. Das ist meine Hoffnung. Dass wir gemeinsam sagen: Nie wieder heißt nie wieder – für alle. Und wir tolerieren keine Heuchelei mehr.