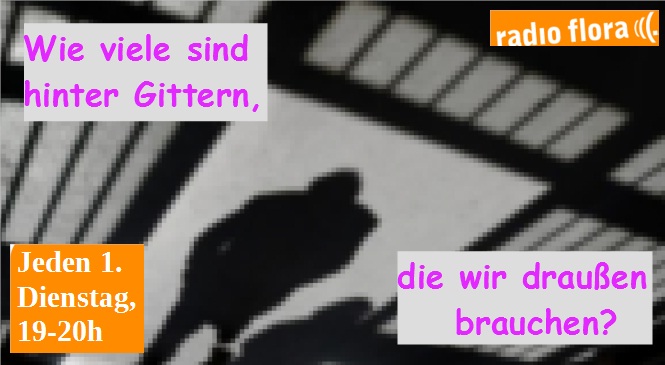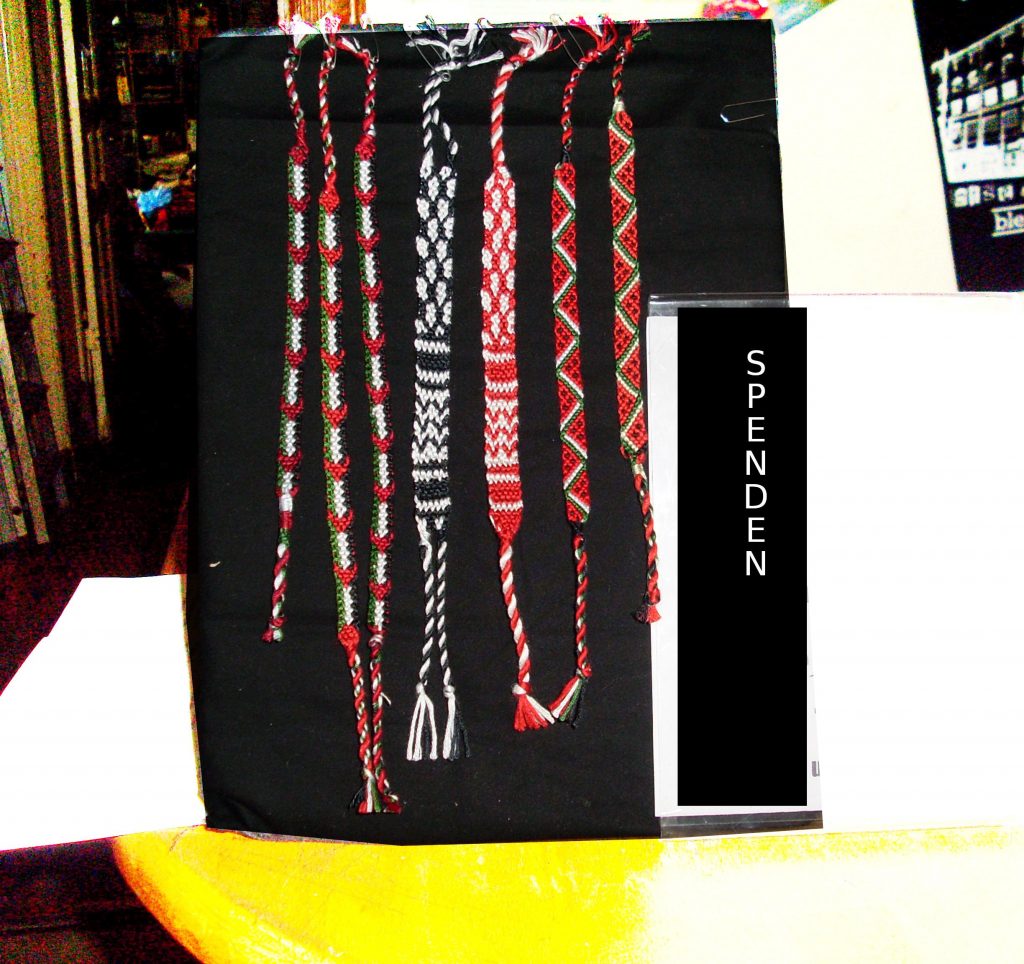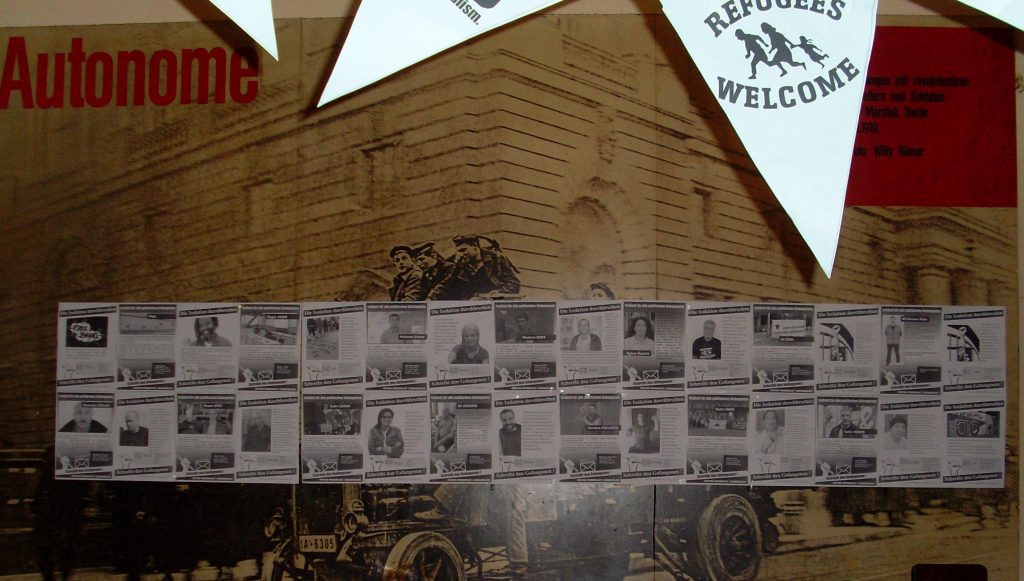Im Zuge des Kampfes um die Freilassung von Antifaschist:in Maja sind auch die Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland wieder stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Das mitteleuropäische Land, das autoritär von Viktor Orbáns Fidesz-Partei regiert wird, ist eng mit der BRD verbunden.
Während deutschlandweit Solidaritätsaktionen gegen die Inhaftierung von Antifaschist:in Maja in Ungarn stattfinden, scheint sich die dortige Justiz kaum zu bewegen. Seit 2010 wird das Land an der Donau durchgehend von der Fidesz-Partei unter Viktor Orbán regiert, der dort eine „illiberale Demokratie“ ausgerufen hat und den Staat autoritär umbaut. Während Orbán in den deutschen Medien immer wieder als Paria und „Putin-Freund“ dargestellt wird, sind die Beziehungen zu Deutschland auf Regierungsebene alles andere als schlecht.
Das Auswärtige Amt rühmt auf seiner Webseite das über 30-jährige Bestehen des deutsch-ungarischen Freundschaftsvertrags, „hochrangige Treffen“ – z.B. vom ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Orbán im Juni vergangenen Jahres – und die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen beiden Ländern. Im Jahr 2024 hatte Orbán im Gespräch mit Bild-Vizechef Paul Ronzheimer schon sein gutes Verhältnis zu Altkanzlerin Angela Merkel gelobt, wobei er Differenzen in der Migrationsfrage einräumte.
Geschichte der deutsch-ungarischen Beziehungen
Das Deutsch-Ungarische Institut für europäische Zusammenarbeit erklärt in einem Artikel über die Beziehungen beider Länder, dass diese bereits „mehr als tausend Jahre alt“ seien. Tatsächlich lassen sich enge Verbindungen zwischen deutschsprachigen und ungarischen Fürstenhäusern bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Seit dem 13. Jahrhundert kam es auch vermehrt zur Ansiedlung von Deutschen in Ungarn, die ihren Höhepunkt unter der Herrschaft des Hauses Habsburg, vor allem mit der Einwanderung der „Donauschwaben“ unter Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) erreichte.
Nach dem Ende des preußisch-österreichischen Machtkampfs um die Herrschaft über die deutschen Gebiete Europas, der im Jahr 1866 zugunsten Preußens entschieden wurde, wandelten die Habsburger zum Ausgleich mit ihren ungarischen Vasallen das Kaisertum Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn um. Diese bestand bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918, in dem das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn als Verbündete gemeinsam gekämpft hatten.
Die engen Verbindungen zum Donaustaat hielt der deutsche Imperialismus auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs aufrecht. Als Adolf Hitler im Jahr 1933 an die Macht kam, war Ungarn bereits seit dreizehn Jahren ein autoritärer Staat unter der Führung des „Reichsverwesers“ Miklós Horthy — und Ministerpräsident Gyula Gömbös von der völkisch-antisemitischen „Rassenschutzpartei“ kam als erster Staatsgast der NSDAP-Regierung nach Berlin. Im November 1940 schloss sich Ungarn im Krieg den Achsenmächten Deutschland, Italien und Japan an. Als Hitler 1944 seine Wehrmacht das Land besetzen ließ, übernahm die faschistische Pfeilkreuzlerbewegung dort die Regierung und beteiligte sich aktiv an der Vernichtungspolitik gegenüber den europäischen Jüd:innen.
Mitteleuropapolitik des deutschen Imperialismus
Die strategische Bedeutung Ungarns für den deutschen Imperialismus erklärt sich aus seiner Lage in Mitteleuropa – dem Kerngebiet deutscher Hegemonialansprüche – und in seiner direkten Nachbarschaft zur Ukraine sowie zum Balkan. Als nicht-slawisches Land eignete sich Ungarn aus deutscher Sicht immer schon besonders gut als Bollwerk gegen die Ausdehnung des russischen Einflussbereichs. Deshalb spielte Ungarn im Kalten Krieg auch eine Schlüsselrolle bei westlichen Zersetzungsversuchen gegenüber dem Ostblock.
Eine wichtige Bedeutung bei der Unterstützung prowestlicher Untergrundbewegungen in den Warschauer-Pakt-Staaten bei gleichzeitiger Förderung des Konzepts „Mitteleuropa“ übernahm etwa die „Paneuropa-Union“ unter dem Vorsitz des letzten österreichischen Thronfolgers Otto von Habsburg (1912-2011). Diese „Einigungsbewegung” war auch im August 1989 an der Organisation der symbolischen Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn beteiligt („Paneuropäisches Picknick“), die heute noch vom Auswärtigen Amt als ein Meilenstein der deutsch-ungarischen Beziehungen gefeiert wird.
Auch Viktor Orbán und das von ihm vorangetriebene politische Gegenmodell zum westlichen Liberalismus passt durchaus in die deutsche Hegemonial-Strategie. Gerade weil sich Orbán innerhalb der EU als Querulant aufführt, bildet er ein gewisses Gegengewicht z.B. zu französischen Bestrebungen um einen weiteren Ausbau der europäischen Institutionen.
Die Bundesregierung konnte und kann sich in diesem andauernden Konflikt als Vermittlerin positionieren, was gerade Angela Merkel meisterhaft verstanden hat. Ungarn bildet heute außerdem einen wichtigen Brückenkopf nach Russland – mit dem Deutschland seine offiziellen diplomatischen Kontakte seit dem Ukraine-Krieg weitgehend herunterfahren musste – sowie nach China, bei dessen Initiative „Neue Seidenstraße“ das Land ein zentraler Partner in Osteuropa ist.
Auch zur amerikanischen Rechten unterhält Orbán beste Beziehungen: Seit 2022 gibt es beispielsweise einen Ableger der jährlichen „Conservative Political Action Conference“ in Budapest. Das Deutsch-Ungarische Institut für europäische Zusammenarbeit wiederum ist ein Ableger des Mathias Corvinius Collegiums Budapest (MCC). Hierbei handelt es sich um eine Fidesz-nahe Denkfabrik, die in den wichtigsten ungarischen Nachbarländern aktiv ist und dort ideologische Arbeit, etwa zur Durchsetzung ultrarechter Narrative in der Migrationspolitik leistet. Die Zusammenarbeit mit Deutschland ist für das MCC von strategischer Bedeutung: der Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts, Bence Bauer, hatte z.B. lange eine führende Position bei der Konrad-Adenauer-Stiftung inne, deren ungarisches Auslandsbüro auch schon einmal als „Auslandswerteunion“ bezeichnet wurde.
Wirtschaftliche Vertretungen
Nicht zuletzt auf wirtschaftlicher Ebene hat der deutsche Imperialismus Ungarn stark durchdrungen: Deutschland ist heute wichtigster Außenhandelspartner und größter ausländischer Investor in dem Land. Nach Angaben der deutschen Außenwirtschaftsagentur Germany Trade and Invest sind rund 2.400 deutsche Investor:innen in Ungarn aktiv und tragen etwa ein Sechstel zum ungarischen BIP bei. Ungefähr 300.000 von insgesamt 9,6 Millionen Ungar:innen arbeiten für deutsche Unternehmen, etwa im weltgrößten Motorenwerk von Audi in Györ oder den Produktionsstätten von BMW, Mercedes und Bosch.
All das zusammengenommen macht Ungarn in der Europastrategie des deutschen Imperialismus zu einem derartigen Schlüsselstaat.